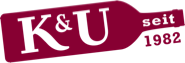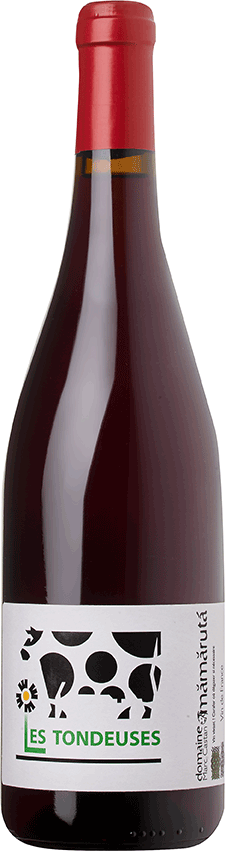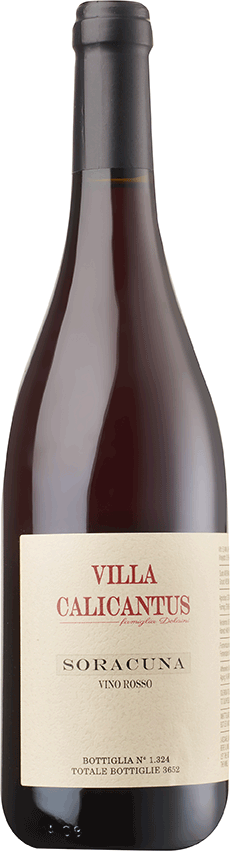Tomate und Umami
Selbst einfachste Gerichte gewinnen durch gekochte Tomaten enorm an geschmacklicher Wirkung. Die Italiener zelebrieren dies in rarer Perfektion. Sie wissen, daß unter den vielen pflanzlichen Lebensmitteln Europas die Tomate der wichtigste Umami-Lieferant ist. Ihr attraktives, vollmundiges Aroma verdankt sie einem hohen Gehalt an Glutamat, einer Aminosäure, die im menschlichen Körper als wichtiger Baustein für Proteine produziert wird. Im zentralen Nervensystem fungiert Glutamat als erregender Neurotransmitter, der eine tragende Rolle bei der Entwicklung unseres Nervensystems und der Gehirnleistung spielt.
Wissenschaftler der Fakultät für Lebensmittelwissenschaften der englischen Universität Reading stellten fest, daß der innere Teil der Tomate einen höheren Glutaminsäuregehalt hat als die rote Haut oder das äußere Fleisch der Tomate. Im Inneren der Tomate entfernt man oft die Samenkerne, doch erwiesen gerade sie sich als intensiver in der Umami-Wirkung. Eine Tomatensauce, die aus der gesamten Tomate produziert wird, enthält demnach das Umami-liefernde Nukleotid Inosinsäure, die sich mit der Glutaminsäure zu einem synergistischen Umami-Effekt verbindet, der die geschmackliche Intensität im Mund deutlich verstärkt. Man sollte für volles Umami-Erlebnis also stets die ganze Tomate verarbeiten.
- (J. Agrar. Food Chem., 55 (14), 5776 -5780, 2007. Unterschiede im Glutaminsäure- und 5'-Ribonukleotidgehalt zwischen Fleisch und Fruchtfleisch von Tomaten und die Beziehung zum Umami-Geschmack
- Maria-Jose Oruna-Concha, Lisa Methven, Heston Blumenthal, Christopher Young und Donald S. Mottram* Department of Food Biosciences, University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6AP, Vereinigtes Königreich, und The Fat Duck Restaurant, Bray, Berkshire SL6 2AQ, Vereinigtes Königreich
Geschichte
Wie der Weizen, die Kartoffel und viele andere unserer heute von uns selbstverständlich verwendeten Lebensmittel ist auch die Tomate ein Immigrant.
Sie kam Anfang des 16. Jahrhunderts nach der Eroberung Mexikos nach Spanien und trat von dort aus als Einwanderer ihren Siegeszug in unsere Kochtöpfe an. Rein äußerlich waren die ersten Tomaten klein und gelbschalig. Nach Italien kamen sie über die spanischen Besitztümer Sardinien und Neapel schon sehr früh. Sie schmückten dort zunächst als botanische Rarität die Gärten der Oberschicht. Das signalisierte Wohlstand, die Besucher waren beeindruckt und so entstand der Name »Pomodoro«, Goldapfel. Er schmückt die zum italienischen Nationalgemüse avancierte Beere bis heute.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Tomate dann in ganz Europa als Zierpflanze genutzt, denn die unbekannten Früchte galten als giftig. Wegen ihrer runden, sinnlichen Form und ihrer intensiven Farbe, die damals noch goldgelb war, hielt man sie lange für den Paradiesapfel, der Adam und Eva verführt hatte. Sie stand im Verdacht, Liebeswahn hervorzurufen und durfte deshalb nicht in die Hände junger Mädchen gelangen.
Verbreitung
Erst ab dem 17. Jahrhundert wird die Tomate in Italien als eßbar entdeckt. Ein Koch des spanischen Vizekönigs von Neapel erwähnt sie in einem von ihm verfassten Kochbuch in drei Gerichten, die er mit dem Zusatz »alla spagnola«, auf spanische Art, versieht.
Die Medici sind es, die die Früchte in Italiens Küche zu integrieren beginnen. Ende des 18. Jahrhunderts findet man in der Encyclopædia Britannica bereits einen Hinweis auf die Tomate als »alltäglich« in der englischen Küche. Es dauert noch einmal knappe 100 Jahre, bis der Goldapfel um 1900 herum auch in Deutschlands Küchen Eingang findet. Dort wird er zunächst vor allem im Süden zu Saucen, Suppen und Salaten verarbeitet.
Im restlichen Deutschland sorgt eine damals weitverbreitete Abneigung gegen das Fremde dafür, daß der ungeliebte Immigrant erst nach 1945 langsam Verbreitung findet. Es dauert noch lange, zum Teil bis in die 1960er Jahre hinein, bis die fremde Beere aus dem Süden die Akzeptanz einer breiteren Kundschaft in Deutschland erfährt. In manch abgelegenem Alpental im Süden oder Dorf im Norden kommt die suspekte Beere sogar erst mit den ersten Supermärkten an ...


Produktion
Ihren Namen haben die bunten Früchte, die aufgrund ihres hohen Gehaltes an Carotinoiden, insbesondere des sekundären Pflanzenwirkstoffes Lycopin, rot, gelb oder orangerot heranreifen, von ihrem ursprünglichen aztekischen Namen »Xictomatl«. Heute ist die Tomate Massenware und es gibt weltweit mehr als 3.100 verschiedene Sorten, vermutlich nochmal so viele wurden nie angemeldet. Jedes Jahr kommen neue Sorten hinzu. In aller Welt arbeiten sich Züchter nicht nur an ihrer Farbe ab, die noch immer als besonders verkaufsfördernd gilt, sondern vor allem auch an ihrer Druck- und Transportfestigkeit, was bisher aber zu Lasten der Qualität geht.
Wie komplex Zusammenhänge in der Natur sind, kann man an der industriellen Tomatenzucht nachverfolgen. Tomaten sind sogenannte Vibrationsbestäuber. Um in der industriellen Produktion einen Fruchtansatz zu erzielen, verwendete man im holländischen Treibhausanbau in den 1980er Jahren elektrische Bestäubungsgeräte, die pro Hektar Arbeitskosten von etwa 10.000 € verursachten. Mitte der 1980er Jahre entdeckte dann ein belgischer Tierarzt, daß dunkle Erdhummeln, die er in einem Tomatentreibhaus ausgesetzt hatte, die Pflanzen überaus wirkungsvoll bestäubten.
Heute ist es internationaler Standard, beim Anbau von Tomaten auf die Bestäubung von Hummeln zu setzen. Ihr Einsatz spart Insektizide und Pestizide. Doch weil es sich dabei meist um industriell vermehrte Tiere von in der Türkei gesammelten dunklen Erdhummeln handelt, verbreiten sich diese auf der ganzen Welt invasiv. Weil sie als Monokultur eingesetzt werden, sorgt seitdem ein Parasit dafür, daß einheimische Hummel-Arten verdrängt werden und aussterben.
Inhaltsstoffe
Die Tomate enthält vor allem Wasser (etwa 95 Prozent). Sie ist jedoch auch reich an Mineralstoffen (vor allem an Kalium), Vitaminen (vor allem, B1, B2, C, E und Niacin), sowie sekundären Pflanzenwirkstoffen wie dem wertvollen Provitamin A und dem Lycopin in roten Tomaten, an organischen Säuren, die den Geschmack entscheidend beeinflussen, sowie wichtigen Spurenelementen wie Silizium und Selen. Allerdings schwanken diese Gehalte je nach Anbaumethode erheblich.
Tatsächlich ist die Tomate eines der wenigen Lebensmittel, das man über mehr als 30 Jahre hinweg systematisch in den Inhaltsstoffen im Unterschied zwischen konventioneller und biologischer Bewirtschaftung untersucht hat. Die Ergebnisse sind so eindeutig, daß sie der breiten Öffentlichkeit bis heute vorenthalten werden. Demnach liefert der biologisch-regenerative Anbau signifikant höhere Nährstoffgehalte, vor allem des wichtigen Radikalenfängers Lycopin. Immer wieder kann man in unterschiedlichsten Publikationen lesen, daß es keinen Unterschied in der Qualität zwischen konventionellem und regenerativem Anbau gäbe. Dies ist durch die Untersuchungen zum Nährstoffgehalt von Tomaten aus beiden Anbausystemen eindeutig widerlegt.
Besonders viele Wirkstoffe und wertvolle Flavonoide stecken in der Schale der Frucht. Den höchsten Lycopin-Gehalt hat man in Tomatenmark gefunden. Die Flavonoide werden aber nur zusammen mit Fetten wie Olivenöl vom Körper aufgenommen. Lycopin sorgt für die rote Farbe, es wirkt antioxidativ, stärkt die Immunabwehr und soll das Risiko bestimmter Krebserkrankungen senken helfen. Allerdings gibt es dazu wissenschaftliche Arbeiten, die sich widersprechen.
Haltbarkeit und Lagerung
Eine reife Tomate ist bis zu 14 Tage haltbar, ohne dabei ihre Inhaltsstoffe zu verlieren. Achtung: Wenn man sie in Kühlräumen oder im Kühlschrank aufbewahrt, verliert sie signifikant an Geschmack und Aroma! Bei Temperaturen unter 12 °C werden wesentliche Geschmacksstoffe wie Isovaleraldehyd, 2-Methyl-1-butanol oder 3-Methyl-1-butanol nicht gebildet. Und weil Tomaten während der Lagerung Etylhen ausscheiden, soll man sie getrennt von anderem Obst und Gemüse lagern. Das Ethylen würde deren Stoffwechsel so beschleunigen, daß sie schneller reifen und verderben.

Der Wein zur Tomate
Reife Tomaten enthalten eine Vielzahl ätherischer Öle und organischer Säuren, die ihnen Geschmack und Aroma verleihen. In der Kombination mit Wein sorgen diese aber auch für vielfältige Störfaktoren. Der Wein zur Tomate will deshalb sorgfältig ausgewählt sein.
Rohe Tomaten, als Salat, mariniert oder mit Pfeffer, Salz und Olivenöl gereicht, sind keine große Herausforderung. Da tut es ein trockener, frischer, würziger Weißwein, wie ein einfacher, trockener, nicht zu gerbstoffbeladener Rotwein.
Kaum aber werden Tomaten gegart, gebraten, geschmort oder zu Sugi und Saucen eingekocht, wird ihr charakteristisches Säurespiel zur Herausforderung. Da schmeckt dann ein Rotwein ganz schnell metallisch blechern, seine Gerbstoffe reagieren mit den ätherischen Ölen zu unangenehm bitterem, stumpfem Geschmack und die Säuren machen ihn saurer und spitzer, als er in Wahrheit ist.
Lange haben wir gekocht, probiert und kombiniert, bis wir sie gefunden haben, die idealen Tomatenweine. Ihnen gemein ist, daß sie für sich getrunken nicht unbedingt den ganz großen Spaß liefern, sobald man sie aber zu Tomaten kombiniert, legen sie los. Sie tragen eine wohldefinierte Säureader in sich, die mit der Säure der Tomaten perfekt harmoniert, egal, wie sie präpariert sind. Ihre Gerbstoffe sind durchweg von leichterer Art. Man spürt sie, sie sind vorhanden, können auch präsent spröde wirken auf der Zunge und herb und trocken agieren, mit der Tomate aber werden sie glatt und freundlich, »dienlich« fruchtig und dienen dem Zusammenspiel hervorragend.
Ein letzter Tipp: Servieren Sie unsere Rotweine zur Tomate mal dezent gekühlt.