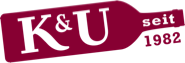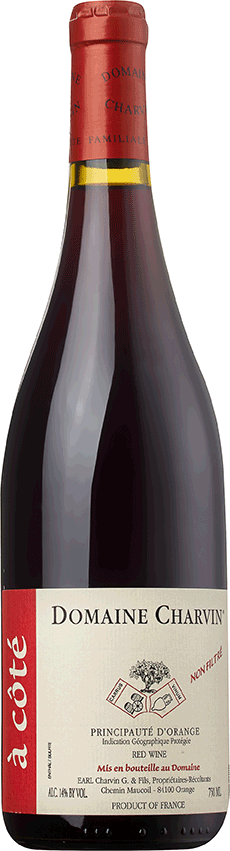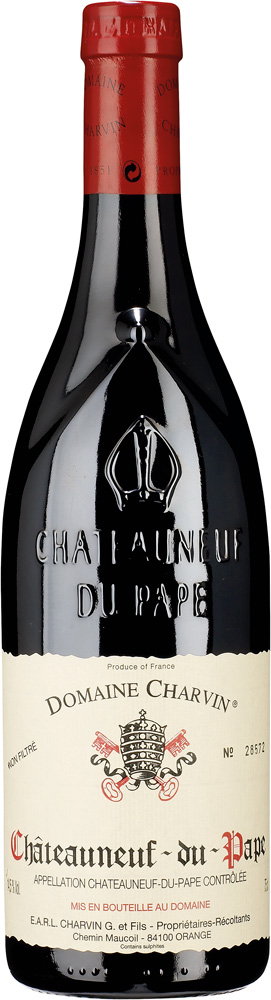Mit seinen fast zweitausend Metern Höhe dominiert der Mont Ventoux (oben im Bild) nicht nur das Landschaftsbild im südlichen Teil des Rhônetals, der »Windumbrauste«, wie sich sein Name übersetzten läßt, prägt auch das Wetter. Berühmt gemacht hat ihn die Tour de France. Sein Anstieg von bis zu 14 Prozent wurde schon manchem Radsportler zum Schicksal. Für die Weinberge und Winzer der »Côtes du Rhône« ist sein kahler, von riesigen Schotterfeldern weiß leuchtender Gipfel Wahrzeichen und Symbol gleichermaßen, denn er bestimmt über Wind und Wetter und ist somit auch ihr Schicksalsberg.
Wenn im Winter der Mistral durch das Rhônetal pfeift, klappern nicht nur die Dachziegel auf den Häusern, es wird auch bitterkalt. Im Sommer hingegen schwirrt hier die Luft meist vor Hitze. Der Himmel ist blau, die Sonne brennt erbarmungslos, die Zikaden machen ihre unverwechselbare Musik und hin und wieder entlädt sich ein mehr oder weniger heftiges Gewitter, das für Wasser und Abkühlung sorgt – sofern alles gut geht, der Regen nicht im Übermaß und nicht als Hagel niedergeht und der Mistral die Trauben trocknet, bevor Schimmelpilze und Essigbakterien sich breit machen. Dann reifen hier die Trauben für ganz eigenständige Weine heran, von denen viele kaum mehr kennen als den Namen: Côtes du Rhône. Das klingt zunächst so, als würden alle Weine von dort mehr oder weniger gleich schmecken.
Tatsächlich aber ist die südliche Rhône, bekannt als die »Côtes du Rhône«, eine erstaunlich bunte und dynamische Region im Aufbruch. Sie ist nicht nur die Heimat einer glyphosatfreien Appellation, 2017 besaßen immerhin schon 18% der Betriebe im Département Vaucluse ein Bio-Zertifikat oder befanden sich in Umstellung (9.500 ha), im Drôme waren es 15 Prozent (3.400 Hektar) und in der Ardèche acht Prozent (800 Hektar). Es sind die besonderen klimatischen Bedingungen entlang der südlichen Rhône, allen voran der trocknende Einfluss des Mistrals, die Weinbau ohne den Einsatz chemischer Spritzmittel hier einfacher machen als anderswo. Deshalb setzen sogar die flächenmäßig dominierenden Genossenschaften inzwischen auf Qualität. Seit ein paar Jahren unterstützt auch der offizielle Winzerverband seine Mitglieder im Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit, man hat die Zeichen der Zeit und des Zeitgeistes verstanden, spürt den Klimawandel im Nacken und will nun als gesamte Region nachhaltiger wirtschaften.
Auf den Außenstehenden wirkt nicht nur die Vielzahl der Appellationen der südlichen Rhône verwirrend, auch die Tatsache, daß ein Côtes du Rhône fast immer ein Verschnitt verschiedener Rebsorten ist, trägt nicht gerade zum Verständnis bei. Es sind drei Rebsorten, die zu zwei Dritteln die Weinberge der Côtes du Rhône dominieren: Grenache, Syrah und Mourvèdre. Trotzdem schmecken die Weine je nach Herkunft, Lage und Boden erstaunlich unterschiedlich. Wie kein anderes Land der Welt hat Frankreich schon in den 1930er Jahren den Zusammenhang von Herkunft und besonderem geschmacklichen Charakter als Qualitätsmerkmal nicht nur verstanden, sondern in ein faszinierend stimmiges Appellations-System übersetzt, das nicht umsonst international (auch in der neuen Welt) als Vorbild in Landwirtschaft und Weinbau dient. Dabei spielt je nach Region und Lage z. B. die Dicke der Erdauflage eine Rolle, deren Fähigkeit Wasser zu speichern, die Beschaffenheit des Unterbodens, die Höhe der Lage, die Dauer der Sonneneinstrahlung, der Zeitpunkt der Traubenreife u.v.a.m.
Die Côtes du Rhône entlang des südlichen Flußlaufes ist ein riesiges Weinbaugebiet mit rund 48.000 Hektar Rebfläche, auf der rund 5.000 Bauern Trauben für Genossenschaften produzieren und 2.000 Winzer unter eigenem Etikett abfüllen. Dabei regelt innerhalb der Appellation jede deklarierte Weinbaugemeinde über entsprechende Lastenhefte die Ansprüche an ihre spezifische lokale Qualität, von den Rebsorten über die Pflanzungsdichte bis zu erlaubten Erträgen, sie machen Vorgaben über Maschinen- oder Handlese und regeln sogar den Ausbau im Keller. Das sind klare Qualitätskriterien, die auch entsprechend überwacht werden. So entstand innerhalb der Appellation »Côte du Rhône« ein präzise abgestuftes Qualitätssystem, das 95 Weinbaugemeinden erlaubt, die 22 besten ihrer Lagen als »Dorfweine«, den sogenannten »Côtes du Rhône Villages«, zu deklarieren. Diese schmecken weniger fruchtig und charmant als die Basisweine der »Côtes du Rhône«, wirken dichter, kraft- und anspruchsvoller und unterscheiden sich profiliert im Charakter ihrer jeweiligen Herkunft.
So verleihen beispielsweise die berühmten »Galets roulets«, die im ehemaligen Flußbett der Rhône über Jahrmillionen aufgeschütteten runden Kieselsteine, ihren Weinen unverwechselbar warme Eigenart mit kraftvoller Gerbstoffdichte und expressiv würzigem Bukett. Die Weine, die auf den tiefgründigen Lehm- und Kalkböden flußabwärts rechts der Rhône auf den Hügeln der Ardèche und des Departements Gard entstehen, wirken dagegen kühler, dunkelfruchtiger und eleganter. Die Weine der berühmten Gemeinden entlang der »Route des vins« auf der linken Seite des Flußbettes werden je nach Höhe ihrer Lagen über dem Flußbett von mehr oder weniger tiefen Kalk- und Lehmböden dominiert, entstehen aber auch auf Galets roulets, und sind insofern zwar weniger einheitlich in Stil und Charakter als die rechte Seite oder der Talgrund, dafür aber besitzt jede einzelne Lage ein spannend eigenständiges, deutlich unterscheidbares Profil.
Das hat seinen Ursprung u. a. im jeweiligen Anteil der reduktiv wirkenden Sorten Syrah und Mourvèdre, die mindestens 20% der Cuvée ausmachen müssen, um die zur Oxidation neigende Grenache auf natürliche Weise vor schnellem Verderb zu schützen. Die Grenache ist nicht umsonst die Leit-Sorte der südlichen Côtes du Rhône, weil ihre Reben und Blätter der Kraft des auch im Sommer heftig durch das Tal blasenden Mistrals problemlos standhalten. Sie muß zu mindestens 30% in jeder Cuvée enthalten sein. Deshalb also sind die Weine der südlichen Rhône fast immer Cuvées. Sie werden meist erst nach dem fertigen Ausbau der einzelnen Rebsorten zusammengestellt. Cuvées als natürlicher Schutz vor Oxidation. Gewußt wie.
Die Basisweine der »Côtes du Rhône« schließlich sind vorbildlich ehrliche und authentische Weine, die noch immer zu den preiswertesten des Weinmarktes gehören. Sie sind weniger fein als trinkfröhlich deftig, spielen mit Frucht und reizvoller Würze, die je nach Zusammensetzung der Cuvée an Minze, Pinie, Wacholder, Rosmarin, Thymian, Veilchen oder schwarze Oliven erinnert. Dabei sorgt die Rebsorte Grenache für kraftvollen Körper mit sattem Alkoholgehalt, man erkennt sie stets an ihrem Duft nach frisch vermahlenem schwarzem und weißem Pfeffer, wogegen die »kühlenden« Rebsorten Syrah und Mourvèdre vor allem aus der Hand ambitionierter Winzerinnen und Winzer für erstaunlich frische und kühl wirkende Lebendigkeit im Mundgefühl sorgen. Genießen sie gute Côtes du Rhônes dezent kühl serviert. Sie begleiten gute wie deftige regionale Küche (auch unsere deutsche!) hervorragend und gehören zu den wohl preiswertesten Weinfreuden des Alltags.
Mit seinen fast zweitausend Metern Höhe dominiert der Mont Ventoux (oben im Bild) nicht nur das Landschaftsbild im südlichen Teil des Rhônetals, der »Windumbrauste«, wie sich sein Name übersetzten läßt, prägt auch das Wetter. Berühmt gemacht hat ihn die Tour de France. Sein Anstieg von bis zu 14 Prozent wurde schon manchem Radsportler zum Schicksal. Für die Weinberge und Winzer der »Côtes du Rhône« ist sein kahler, von riesigen Schotterfeldern weiß leuchtender Gipfel Wahrzeichen und Symbol gleichermaßen, denn er bestimmt über Wind und Wetter und ist somit auch ihr Schicksalsberg.
Wenn im Winter der Mistral durch das Rhônetal pfeift, klappern nicht nur die Dachziegel auf den Häusern, es wird auch bitterkalt. Im Sommer hingegen schwirrt hier die Luft meist vor Hitze. Der Himmel ist blau, die Sonne brennt erbarmungslos, die Zikaden machen ihre unverwechselbare Musik und hin und wieder entlädt sich ein mehr oder weniger heftiges Gewitter, das für Wasser und Abkühlung sorgt – sofern alles gut geht, der Regen nicht im Übermaß und nicht als Hagel niedergeht und der Mistral die Trauben trocknet, bevor Schimmelpilze und Essigbakterien sich breit machen. Dann reifen hier die Trauben für ganz eigenständige Weine heran, von denen viele kaum mehr kennen als den Namen: Côtes du Rhône. Das klingt zunächst so, als würden alle Weine von dort mehr oder weniger gleich schmecken.
Tatsächlich aber ist die südliche Rhône, bekannt als die »Côtes du Rhône«, eine erstaunlich bunte und dynamische Region im Aufbruch. Sie ist nicht nur die Heimat einer glyphosatfreien Appellation, 2017 besaßen immerhin schon 18% der Betriebe im Département Vaucluse ein Bio-Zertifikat oder befanden sich in Umstellung (9.500 ha), im Drôme waren es 15 Prozent (3.400 Hektar) und in der Ardèche acht Prozent (800 Hektar). Es sind die besonderen klimatischen Bedingungen entlang der südlichen Rhône, allen voran der trocknende Einfluss des Mistrals, die Weinbau ohne den Einsatz chemischer Spritzmittel hier einfacher machen als anderswo. Deshalb setzen sogar die flächenmäßig dominierenden Genossenschaften inzwischen auf Qualität. Seit ein paar Jahren unterstützt auch der offizielle Winzerverband seine Mitglieder im Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit, man hat die Zeichen der Zeit und des Zeitgeistes verstanden, spürt den Klimawandel im Nacken und will nun als gesamte Region nachhaltiger wirtschaften.
Auf den Außenstehenden wirkt nicht nur die Vielzahl der Appellationen der südlichen Rhône verwirrend, auch die Tatsache, daß ein Côtes du Rhône fast immer ein Verschnitt verschiedener Rebsorten ist, trägt nicht gerade zum Verständnis bei. Es sind drei Rebsorten, die zu zwei Dritteln die Weinberge der Côtes du Rhône dominieren: Grenache, Syrah und Mourvèdre. Trotzdem schmecken die Weine je nach Herkunft, Lage und Boden erstaunlich unterschiedlich. Wie kein anderes Land der Welt hat Frankreich schon in den 1930er Jahren den Zusammenhang von Herkunft und besonderem geschmacklichen Charakter als Qualitätsmerkmal nicht nur verstanden, sondern in ein faszinierend stimmiges Appellations-System übersetzt, das nicht umsonst international (auch in der neuen Welt) als Vorbild in Landwirtschaft und Weinbau dient. Dabei spielt je nach Region und Lage z. B. die Dicke der Erdauflage eine Rolle, deren Fähigkeit Wasser zu speichern, die Beschaffenheit des Unterbodens, die Höhe der Lage, die Dauer der Sonneneinstrahlung, der Zeitpunkt der Traubenreife u.v.a.m.
Die Côtes du Rhône entlang des südlichen Flußlaufes ist ein riesiges Weinbaugebiet mit rund 48.000 Hektar Rebfläche, auf der rund 5.000 Bauern Trauben für Genossenschaften produzieren und 2.000 Winzer unter eigenem Etikett abfüllen. Dabei regelt innerhalb der Appellation jede deklarierte Weinbaugemeinde über entsprechende Lastenhefte die Ansprüche an ihre spezifische lokale Qualität, von den Rebsorten über die Pflanzungsdichte bis zu erlaubten Erträgen, sie machen Vorgaben über Maschinen- oder Handlese und regeln sogar den Ausbau im Keller. Das sind klare Qualitätskriterien, die auch entsprechend überwacht werden. So entstand innerhalb der Appellation »Côte du Rhône« ein präzise abgestuftes Qualitätssystem, das 95 Weinbaugemeinden erlaubt, die 22 besten ihrer Lagen als »Dorfweine«, den sogenannten »Côtes du Rhône Villages«, zu deklarieren. Diese schmecken weniger fruchtig und charmant als die Basisweine der »Côtes du Rhône«, wirken dichter, kraft- und anspruchsvoller und unterscheiden sich profiliert im Charakter ihrer jeweiligen Herkunft.
So verleihen beispielsweise die berühmten »Galets roulets«, die im ehemaligen Flußbett der Rhône über Jahrmillionen aufgeschütteten runden Kieselsteine, ihren Weinen unverwechselbar warme Eigenart mit kraftvoller Gerbstoffdichte und expressiv würzigem Bukett. Die Weine, die auf den tiefgründigen Lehm- und Kalkböden flußabwärts rechts der Rhône auf den Hügeln der Ardèche und des Departements Gard entstehen, wirken dagegen kühler, dunkelfruchtiger und eleganter. Die Weine der berühmten Gemeinden entlang der »Route des vins« auf der linken Seite des Flußbettes werden je nach Höhe ihrer Lagen über dem Flußbett von mehr oder weniger tiefen Kalk- und Lehmböden dominiert, entstehen aber auch auf Galets roulets, und sind insofern zwar weniger einheitlich in Stil und Charakter als die rechte Seite oder der Talgrund, dafür aber besitzt jede einzelne Lage ein spannend eigenständiges, deutlich unterscheidbares Profil.
Das hat seinen Ursprung u. a. im jeweiligen Anteil der reduktiv wirkenden Sorten Syrah und Mourvèdre, die mindestens 20% der Cuvée ausmachen müssen, um die zur Oxidation neigende Grenache auf natürliche Weise vor schnellem Verderb zu schützen. Die Grenache ist nicht umsonst die Leit-Sorte der südlichen Côtes du Rhône, weil ihre Reben und Blätter der Kraft des auch im Sommer heftig durch das Tal blasenden Mistrals problemlos standhalten. Sie muß zu mindestens 30% in jeder Cuvée enthalten sein. Deshalb also sind die Weine der südlichen Rhône fast immer Cuvées. Sie werden meist erst nach dem fertigen Ausbau der einzelnen Rebsorten zusammengestellt. Cuvées als natürlicher Schutz vor Oxidation. Gewußt wie.
Die Basisweine der »Côtes du Rhône« schließlich sind vorbildlich ehrliche und authentische Weine, die noch immer zu den preiswertesten des Weinmarktes gehören. Sie sind weniger fein als trinkfröhlich deftig, spielen mit Frucht und reizvoller Würze, die je nach Zusammensetzung der Cuvée an Minze, Pinie, Wacholder, Rosmarin, Thymian, Veilchen oder schwarze Oliven erinnert. Dabei sorgt die Rebsorte Grenache für kraftvollen Körper mit sattem Alkoholgehalt, man erkennt sie stets an ihrem Duft nach frisch vermahlenem schwarzem und weißem Pfeffer, wogegen die »kühlenden« Rebsorten Syrah und Mourvèdre vor allem aus der Hand ambitionierter Winzerinnen und Winzer für erstaunlich frische und kühl wirkende Lebendigkeit im Mundgefühl sorgen. Genießen sie gute Côtes du Rhônes dezent kühl serviert. Sie begleiten gute wie deftige regionale Küche (auch unsere deutsche!) hervorragend und gehören zu den wohl preiswertesten Weinfreuden des Alltags.
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (16,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (27,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (28,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (28,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (40,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (40,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (41,20 €* / 1 l)
Inhalt: 1.5 l (22,67 €* / 1 l)
Inhalt: 1.5 l (23,27 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (62,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (69,33 €* / 1 l)