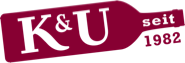Es ist unbestritten, daß übermäßiger Alkoholkonsum gesundheitsschädigend ist. Doch daß die Wochenzeitungen »Die Zeit« und der »Spiegel« in permanenter Anti-Alkohol-Artikelflut meinen, das Thema forcieren zu müssen, hat mit Journalismus wenig zu tun. Die Aufgabe eines guten Journalisten ist es, den Wahrheitsgehalt seiner Informations-Quellen sicherzustellen, um dann entsprechend faktenbasiert das Thema anzugehen. Die Faktenlage in Sachen Alkoholismus ist aber weit komplexer, als sie derzeit in der Presse dargestellt wird. Statt die wahren Gründe überzogenen Alkoholmißbrauchs zu benennen, die vielfältig sind, sehr oft aber direkt mit sozialpolitischem Versagen der Politik zu korrelieren sind, wird ein reichlich scheinheiliger Stellvertreterkrieg angezettelt, der auf die Anti-Alkohol-Kampagne der Guttempler in den USA zurückgeht und von der WHO und dem Gesundheitsministerium der USA gezielt lanciert wird.
Da wird nicht versucht, die angeblich eindeutigen Krebs-und Krankheitsfälle durch Alkoholmissbrauch im Kontext entsprechender Pestizidbelastungen, der rasant zunehmenden Feinstaub- und Mikroplastik-Belastung, von Industrieabgasen, Wohngiften, Bewegungsmangel, sozialem Lebensumfeld, Arbeitsbedingungen und falscher Ernährung zu differenzieren.
Statt die allmächtige Alltagsdroge Zucker mit aller Macht und Konsequenz zu bekämpfen, was in Anbetracht der Markt- und Lobbymacht der einschlägigen Ernährungskonzerne praktisch nicht stattfindet, bekämpft man die Droge Alkohol mit blindwütiger Inbrunst, die längst ideologische Züge angenommen hat.
Auch wir finden es höchst bedenklich, daß im gesellschaftlichen Leben offensichtlich nichts ohne Alkohol geht, zumal unter Männern. Ein Fußballspiel ohne Alkohol ist kaum vorstellbar. Wer nachts ausgeht, glüht vor. Die typischen Männlichkeits-Rituale sind ohne Alkohol undenkbar. Unter Pubertierenden gilt Alkoholkonsum als Beweis der Stärke. Viele Reiche und Schöne der Welt schmücken sich mit teuren Alkoholika, weil sie für eine Kultur stehen, die sie selbst nicht haben usw. usw...
Wein ist ein Jahrtausende altes soziales Kulturgetränk. Mit ihm knallt man sich gemeinhin nicht die Birne voll. Weintrinkerinnen und Weintrinker haben gelernt, die Droge Alkohol im Wein über den kundigen Genuß zu beherrschen, ein wesentlicher Teil seiner Kultur. Sie sind keine Säufer, sondern Genießer, weil sie wissen, daß die Dosis das Gift macht. Deshalb sind Diskussionen über Wein und Gesundheit sinnfrei, weil bekannt ist, daß das Acetaldehyd als Abbauprodukt des auch im Wein enthaltenen Alkohols Ethanol inzwischen als toxischer gilt, als der Alkohol selbst. Daran führt kein Weg vorbei. Deshalb vermeiden kundige Genießer den Kater, der auf die Wirkung dieses Acetaldehyds zurückgeht, durch entsprechende Mäßigung.
Der »Dry January« löst das fatale Alkoholismus-Problem nicht. Dazu bedürfte es grundlegender gesellschaftspolitischer Lösungsansätze. Er mag aber zum Nachdenken anregen über das eigene Konsumverhalten, denn wer weniger, dafür aber bewusster (und vielleicht auch besser) trinkt, und dabei seine Sinne über kritische Selbstreflexion trainiert, lernt nicht nur zu genießen, er wird auch den Alkohol in seiner Wirkung zu kontrollieren und zu beherrschen lernen.