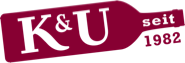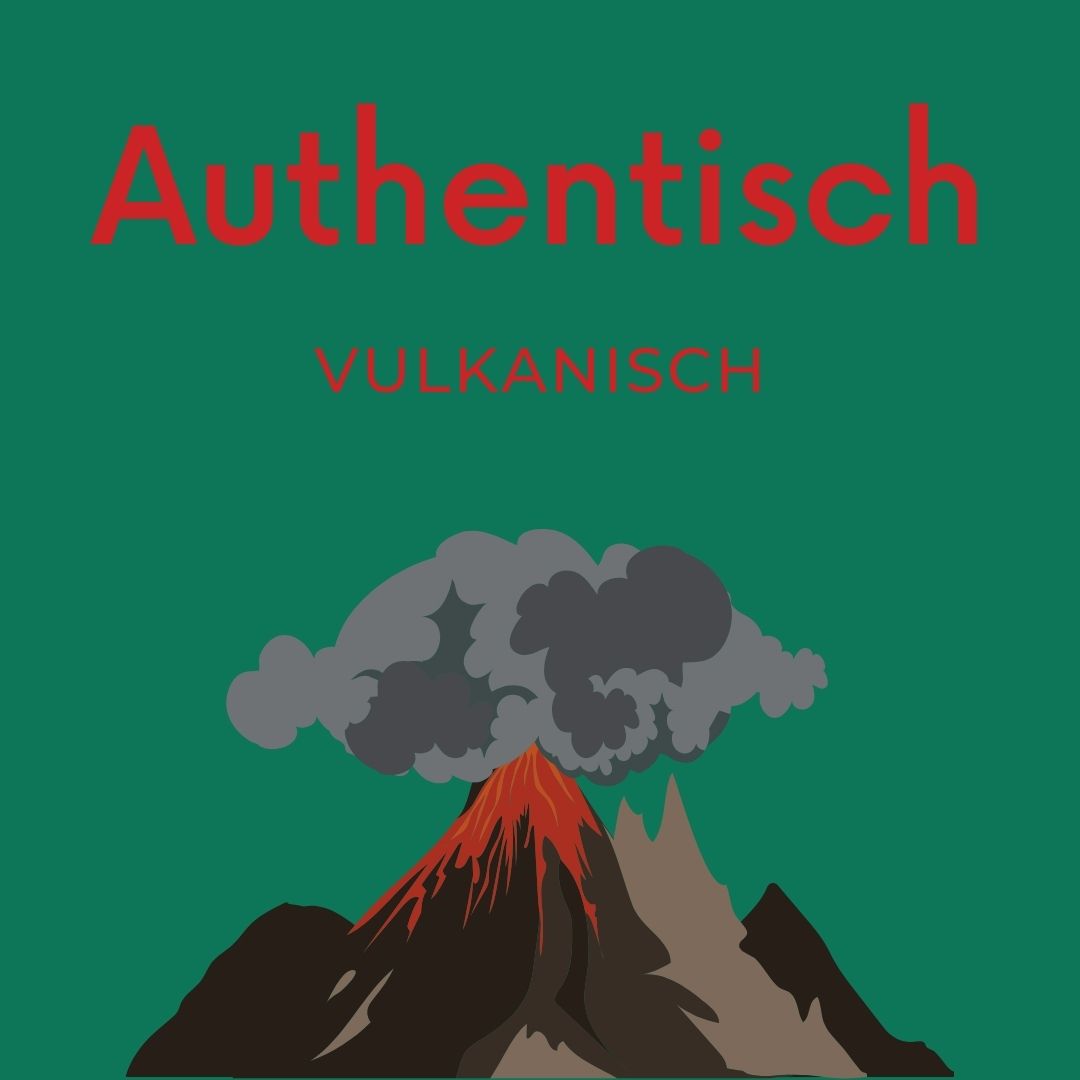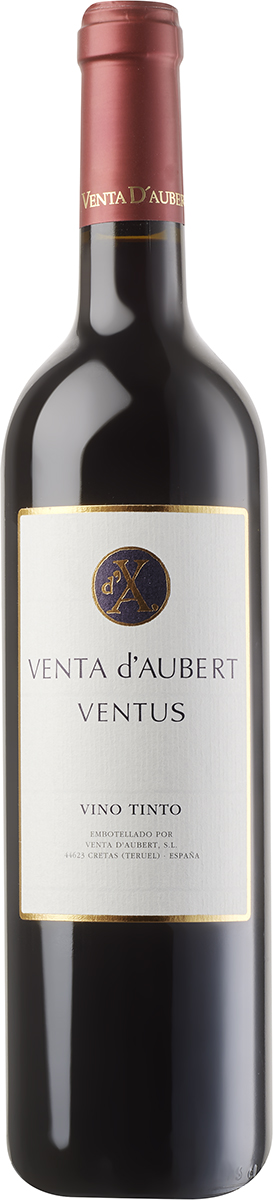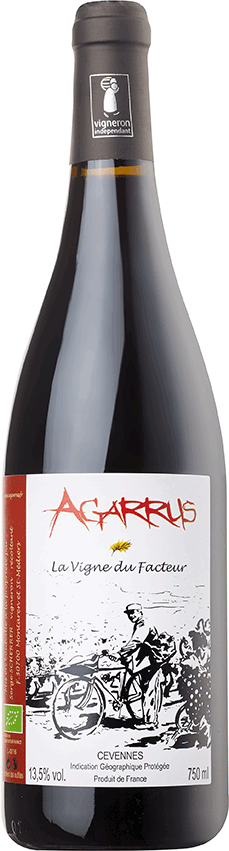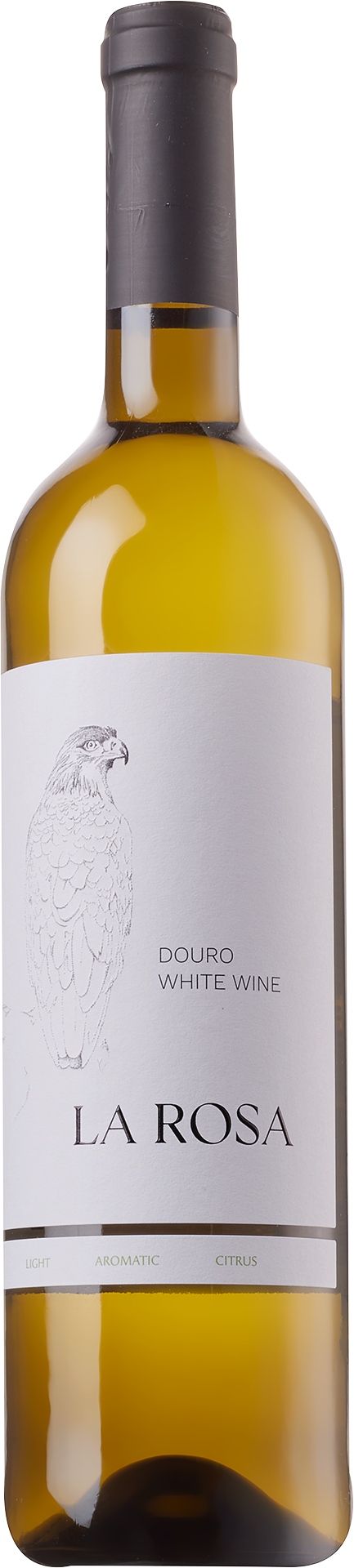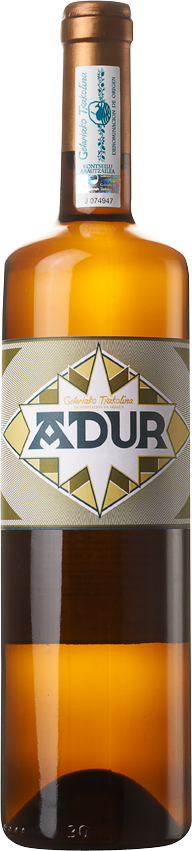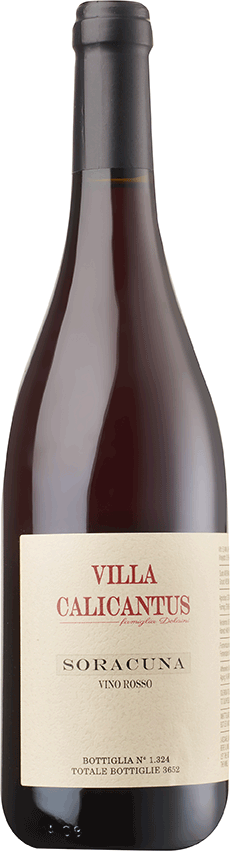Franken
Bescheidenheit ist eine Tugend
... die sich schwer tut gegen jene unverfrorenen Laut-Sprecher, die in Franken das Geschäft an sich zu reißen versuchen. Vater Rainer und Sohn Maximilian Zang aus Nordheim in Franken sind zwei leise auftretende Understatement-Künstler, deren charakterstarke Bio-Weine aus dem traditionellen Holzfaß dem seelenlosen fränkischen Wein-Kommerz eigensinnig persönliche Schattierungen entgegensetzen.
Riso. Reis. Risotto
Risotto geht immer. Mit Pilzen im Herbst. Mit Spargel und dem Gemüse der Saison, luxuriös mit Fisch oder Fleisch - ein guter Risotto ist besser als jede Tiefkühl-Pizza und ähnlich schnell auf dem Tisch (wenn man weiß wie er geht, »der richtige« Risotto).
Im Risotto treffen zwei Philosophien aufeinander. Früher galt er als gut, wenn eine Gabel, die man hineinsteckte, stehen blieb. Man konnte sich damals nicht so viel Butter und Käse leisten, weshalb der Risotto steif und körnig war. Damals war der Reis auch für die nördlichen Provinzen Italiens das, was die Pasta für den Süden war.
Heute sind Risotto und Pasta Aushängeschilder der Küche des ganzen Landes und man kocht den Risotto mit viel Butter und Käse, die man am Ende des Garprozesses unterschlägt, die sogenannte »Mantecatura«, zu cremig weicher Konsistenz, die Wellen schlägt, wenn man den Teller kippt - was die Italiener »all'onda« nennen. Um ein Gefühl für die verschiedenen Phasen seiner an sich einfachen Zubereitung zu bekommen, muß man Risotto öfter zubereiten. Dann lernt man ihn als herzhaftes Gericht aus einfachsten Zutaten zuzubereiten oder ihn raffiniert fein und sinnlich in Szene zu setzen. Merke: Es gibt nur wenige Zutaten, die ein Risotto nicht schmücken.
K&U-Mitarbeiterinnen empfehlen ...
... drei besondere Weine. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nah dran am Geschehen. Sie sprechen die Sprache des Landes und sind regelmäßig vor Ort. Sie kennen unsere Weine oft schon lange, bevor sie auf den Markt kommen. Dabei haben sie die besondere K&U-Perspektive im Blick, denn wir verweigern uns anonymen Punkten und obskuren Bewertungen. Wir suchen selbst vor Ort, was wir abseits des glatten Mainstreams entsprechend unserer fachlichen Kompetenz für besonders interessant, gut und wertig halten. Für diese oft wenig bekannten Weine müssen wir dann den Weg erst bereiten. Begleiten Sie uns doch dabei! Wir empfehlen Ihnen hier jeden Monat drei besondere K&U-Weine, an denen wir uns und unsere Qualitätskriterien gerne messen lassen:
2022 Jurançon sec »Castera«, Domaine Castera, Südwestfrankreich 16,50 €
Dunja Ulbricht: Er war einer der Stars unserer diesjährigen Hausmesse, dieser trockene Weißwein aus dem Pyrenäenvorland im französischen Südwesten. Petit und Gros Manseng heißen seine Rebsorten. Sie verleihen ihm unverwechselbaren Charakter: Da strahlt eine frische Säureader in reifer, dichter gelbwürziger Packung im Mundgefühl, im Duft gelbe Sommerwürze, reifes Obst und nasser Stein. Sehr attraktiv und einladend, aber in diesem spannungsgeladenen Zusammenspiel von Frische und Reife nicht alltäglich. Erinnert an einen Sommermorgen mit blauem Himmel und glasklarer, noch nachtkalter Luft. Wir prophezeien den Weißweinen aus dem Jurançon ein Erwachen auf dem Markt. Dieser knochentrockene Prachtkerl harmoniert vortrefflich zu deftig fetter regionaler Hausmannskost.
2020 Saumur rouge »Les Moulins«, Domaine Guiberteau, Loire 19,50 €
Darja Ulbricht: Romain Guiberteau ist der Kultwinzer in Saumur an der Loire. Nach seinen Lehrjahren bei den Frères Foucault von Clos Rougeard und Wanderjahren quer durch die Weinwelt führt er das fort, was ihm damals widerfuhr: Er fördert junge Talente in Saumur und vernetzt sie mit seinem internationalen Netzwerk. So kam er auch zu Brandon Stater-West, einem jungen Amerikaner, der einige Zeit bei ihm im Keller arbeitete und ihn in der Rotwein-Bereitung dazu animierte, neue Wege zu gehen. Sein »Les Moulins« ist die Basis im Sortiment. Reinsortig Cabernet Franc von Lagen in Bellay und Brézé. Etwas reifer geerntet als üblich, deshalb samtig weich und mundfüllend sympathisch, ohne schwer zu sein. Loire-Cabernet, der delikat und doch potent dicht antritt. Das gibts dort so wohltuend nicht alle Tage!
2018 Teroldego »Portico Rosso«, Alessandro Fanti, Trentino 28,00 €
Martin Kössler: Teroldego Rotaliano ist eigentlich das Monopol, zumindest nach unserem Qualitätsverständnis, von Elisabetta Foradori in Mezzolombardo im Trentino. Mit ihr arbeiten wir nicht umsonst seit fast vierzig Jahren zusammen. Doch als wir Alessandro Fanti hoch über dem Tal von Mezzocorona besuchten und er uns seinen Teroldego präsentierte, waren wir nicht schlecht erstaunt über dessen Andersartigkeit, Dichte und Ausstrahlung. Trotz nicht zimperlichen Alkohols wirkt er kühl und raffiniert dicht gestrickt auf der Zunge, während mächtige Gerbstoffwogen den Mund mit raffinierter Konsistenz füllen. Das können so eigenwillig blau in einer aromatischen Tönung, die an Wacholder und Lorbeer erinnert, nicht viele Rotweine dieser Welt. In seinem Gerbstoff-Samt badet die Zunge gerne.
Crémant. DIE Champagner-Alternative
Während die Champagne von einer Preiserhöhung zur nächsten eilt und sich zunehmend aus dem Markt schießt, feiern Frankreichs Crémants als die werte Alternative fröhliche Verkaufserfolge.
Als Crémant werden in der EU all jene französischen Schaumweine bezeichnet, die in festgelegten Regionen, die außerhalb der Champagne liegen, nach dem Verfahren der Flaschengärung (»méthode champenoise«) produziert werden. Bis im September 1994 die Bezeichnung »Crémant« juristisch definiert wurde, verstand man unter Crémant einen weich schäumenden Champagner, der statt der üblichen 6 bar Druck nur die gesetzliche Mindestforderung von 3,5 bar erfüllte.
Der Unterschied zwischen Crémant und Champagner liegt heute also vor allem in der Herkunft. Während Champagner nur in der Champagne produziert werden darf, kommt Crémant aus ganz bestimmten Regionen in Frankreich. Beide werden ähnlich hergestellt - und können doch sehr unterschiedlich ausfallen.
Viel Wein fürs Geld
Seit vielen Jahren studieren junge Leute Weinbau, die zu Hause kein Weingut haben. Sie sind gut ausgebildet, haben in Weingütern auf der ganzen Welt gearbeitet, wollen nun das eigene Weingut gründen. Dazu suchen sie Rebland in weniger bekannten Regionen, weil es dort noch oft bezahlbar ist. Sie produzieren mit Leidenschaft und Kompetenz Weine aus meist lokal angestammten Rebsorten, technisch brillant realisiert, in Stil und Geschmack eigenständig, selbstbewußt und oft auch originell. Solche Weine suchen wir, egal ob von jungen oder schon arrivierteren Betrieben. Sie werden von Hand geerntet und konsequent handwerklich produziert und rechtfertigen so ihr Preis-Genuß-Verhältnis auf erfreuliche Weise.
Hier eine Auswahl solcher exemplarisch ihren Preis werten Weiß- und Rotweine. Ideale Essensbegleiter. Aus zertifiziert biologischem Anbau. Manche sind Naturweine, maßvoll, minimal oder gar nicht geschwefelt. Alle sind sie spontan vergoren, realisiert ohne die Zusatzstoffe der Önologie, sie stammen aus überschaubar dimensionierten Familienbetrieben und stehen für traditionelles Winzerhandwerk im besten Sinne des Wortes.
Der Frühling und sein Wein
Im Frühling freut man sich auf die frischen grünen Gemüse der beginnenden Freiluft-Saison. Das Chlorophyll lockt mit seinem grünen Reiz. Dem Spargel widmen wir anderswo ein spezielles Angebot. Hier soll es um die ersten Freiluft-Gemüse gehen. Um Radieschen, den berühmten Mai-Spitzkohl, die ersten Blattsalate, die nicht aus dem Gewächshaus kommen, also um die ersten Gemüse der Region und nicht um jene leidige spanische Importware, die den ganzen Winter über in den Auslagen lag und den Spaniern (meist illegal) das Wasser abgräbt. Zu diesen Vegetabilien empfehlen wir Weine voller Frische, die geschmacklich attraktiv und vielfältig und aromatisch aufregend Ihre Küche des Frühlings zu begleiten verstehen.
Hängen Sie sich in der Kombination von Speis und Trank nicht zu sehr am Detail auf. Wir haben hier einen Leitfaden formuliert, der in der eigenen Küche mit Leben erfüllt sein will. Legen Sie los! Hier finden Sie schmackhafte Begleiter Ihrer Frühlingsküche:
Rebsorten erleben: Chenin Blanc & Cabernet Franc
Die beiden großen Rebsorten der Loire, Chenin Blanc in weiß und Cabernet Franc in rot, machen Frankreich erst zu dem großen Weinland, das es ist. Vielfalt statt Einfalt.
Chenin Blanc ist eine der wenigen weißen Rebsorten der Weinwelt, die man »elastisch« nennen kann. Man kann sie früh lesen, um daraus brillante Schaumweine zu produzieren. Aus dem gleichen Weinberg kann man bei späterer Lese große trockene Weißweine keltern. Wenn man die Trauben mit Edelfäulebefall spät im Herbst erntet, sind große Weltklasse-Süßweine mit vielen hundert Gramm Zucker möglich, deren Süß-Säure-Balance einmalig ausfällt. Immer zeigt die Rebsorte Charakter und Eigenart, sie hat etwas Edles an sich, besitzt eine aromatische Komplexität, wie sie nur wenige andere weißen Rebsorten entfalten; je nach Lage und Herkunft kann sie eine Mineralität entwickeln, der man oberflächlich unterstellen könnte sauer, mager und »dünn« zu schmecken, tatsächlich katapultiert sie ihre Weine aber in die absolute Spitzenklasse im Weißwein. Eine Rebsorte für jedermann ist sie also nicht, aber jedermann könnte sie verstehen, wenn er nur wollte (und könnte). Große Chenin Blanc weist interessante Ähnlichkeiten auf mit großem Furmint aus Ungarn, sowie den neuen trockenen Xarel-los aus Spanien. Die Weinwelt im Wandel.
Cabernet Franc tut sich schwer gegen den viel berühmteren Bruder Cabernet Sauvignon. Feiner, kühler und raffinierter im Trunk fällt er aus und ist deutlich empfindlicher und anspruchsvoller im Anbau. Sein Erntefenster ist viel kleiner und entscheidet kritisch über sein aromatisches Profil. Es fiel in der Vergangenheit oft unangenehm grasig, unattraktiv herb und unreif aus. Das hat die Klimakrise verändert. Heute müssen seine Winzer aufpassen, daß nicht plumpe, überreife Rumtopf-Aromen den raffinierten Duft der empfindlichen Rebsorte kontaminieren und ihrem Wein Spannung und Lebendigkeit nehmen, was ganz schnell gehen kann. Inzwischen nehmen sich immer mehr engagierte Winzerinnen und Winzer der ungeliebten Rebsorte wieder sehr bewußt an, weil sie sich in Zeiten der Klimakrise auf ganz neue qualitative Höhen treiben läßt. Hier exemplarisch für viele andere in unserem Programm zu erleben.
»WEIN RADIKAL ANDERS«
Kultur- und traditionelle Naturweine aus radikal anderem Handels-Konzept. Eingekauft und kommuniziert in kompetent kritischer Sicht auf Viefalt, Rebe, Boden, Gärung, Mensch und Wein
Neu auf Lager
Alle aktuellen Zugänge in der Reihenfolge ihres Eintreffens. Wenn Sie hier regelmäßig vorbeischauen, verpassen Sie weder Ihren Lieblings-Winzer noch Ihren Lieblings-Wein und sind stets über unsere Neueinkäufe informiert.
Die Rubrik ist so aktuell, daß manchmal noch Flasche und Beschreibung fehlen. Wir reichen sie umgehend nach, denn wir schreiben sie persönlich, weil unsere Weinbeschreibungen Ihnen geschmacklich nachvollziehbare und sprachlich verständliche Orientierung bieten möchten - ohne die vielen Adjektive und Superlative, für die unsere Branche so berühmt wie berüchtigt ist.
Küche & Wein
40 Jahre K&U. Das Video