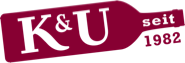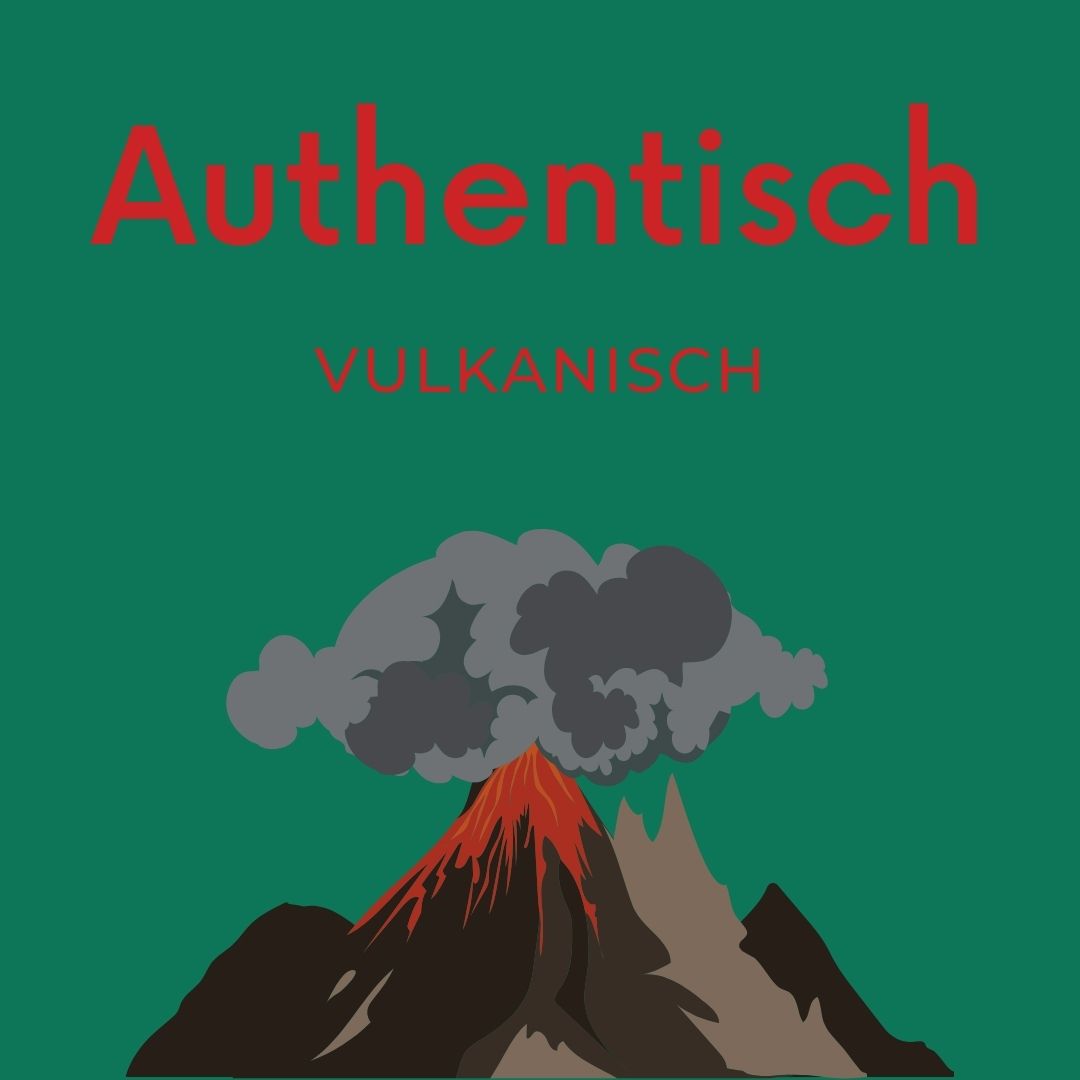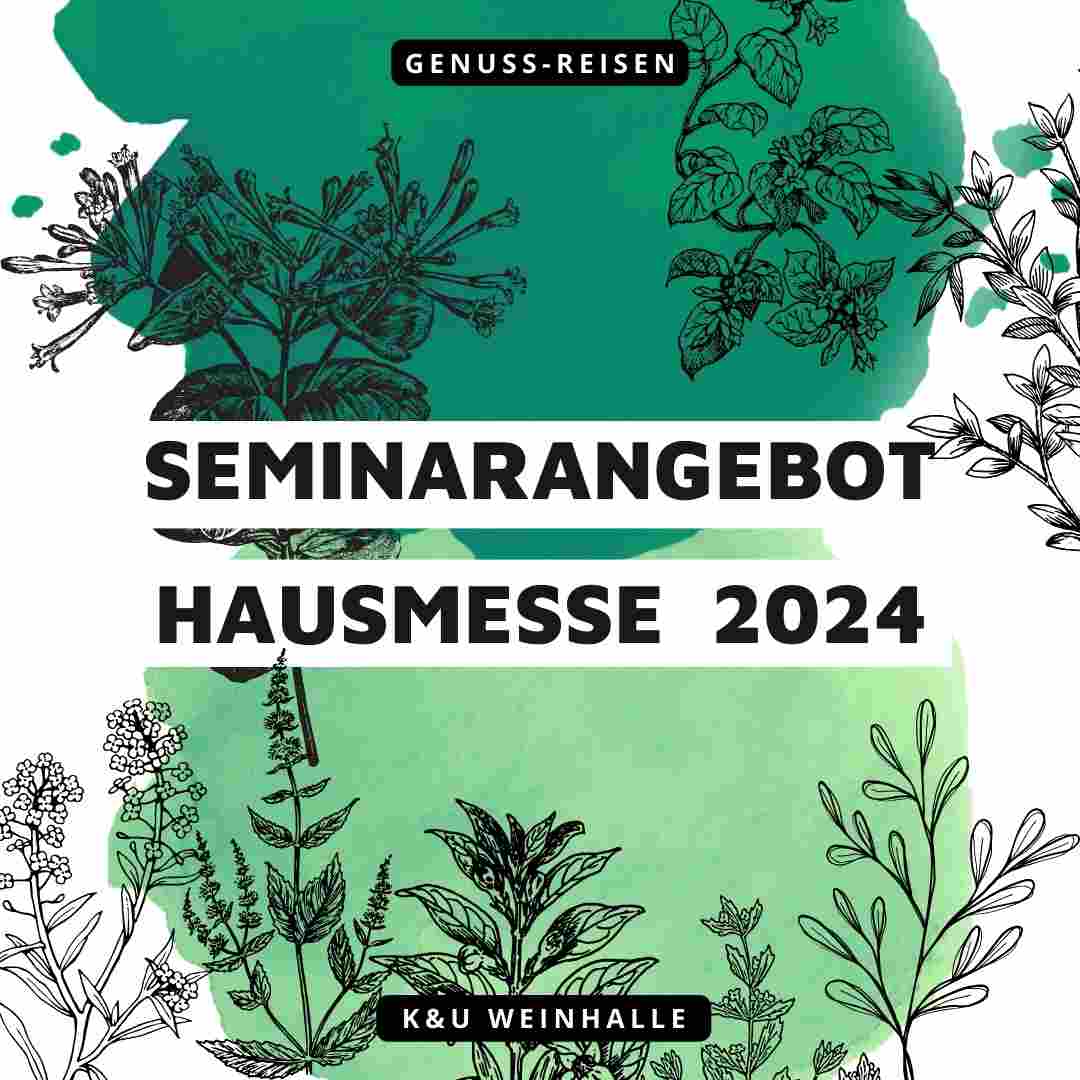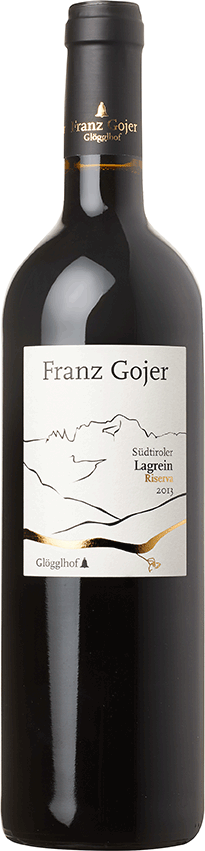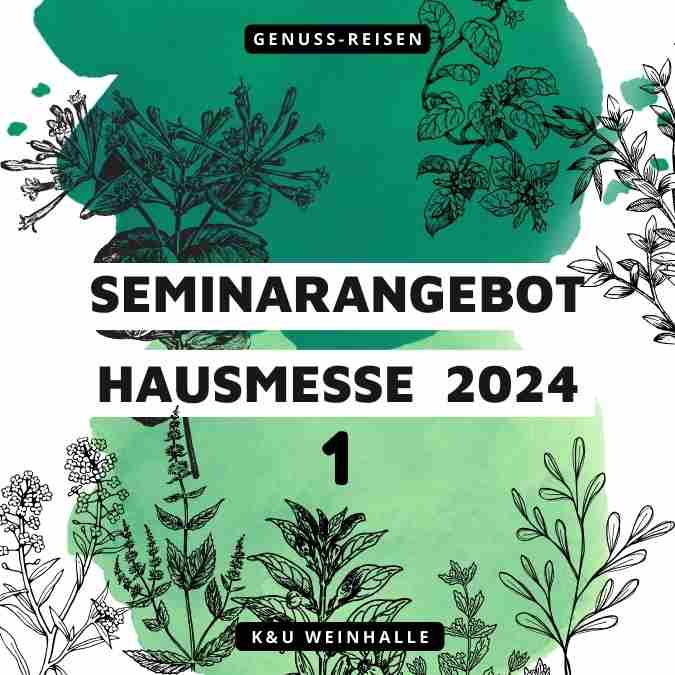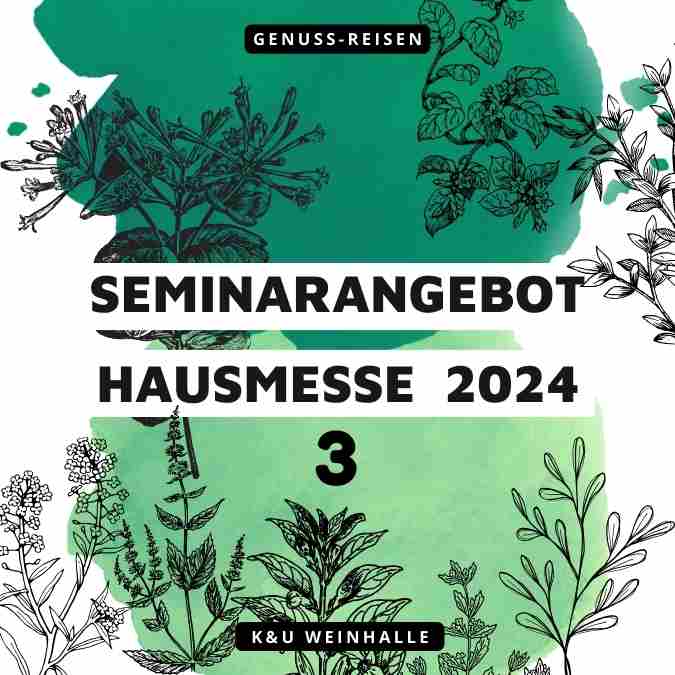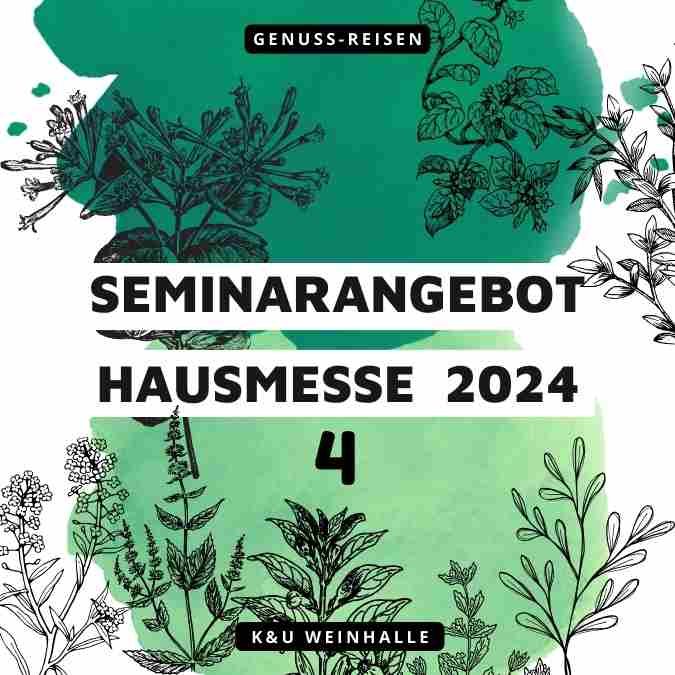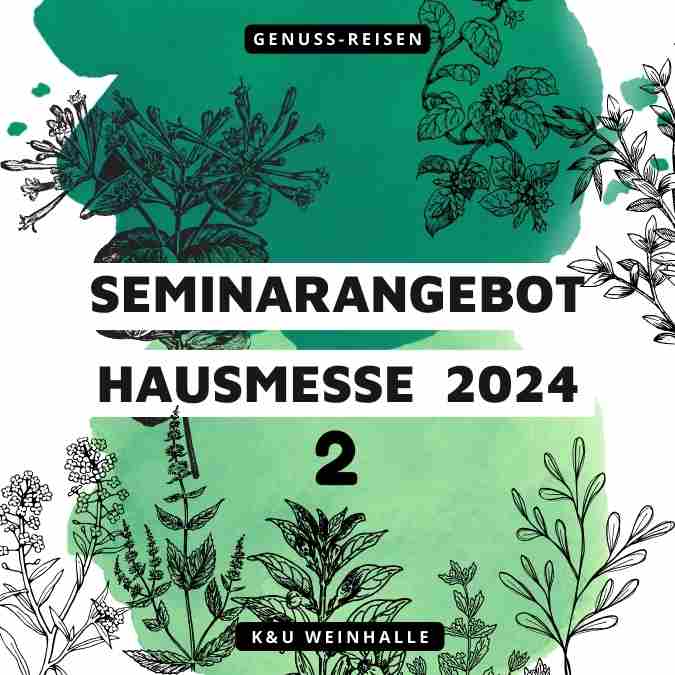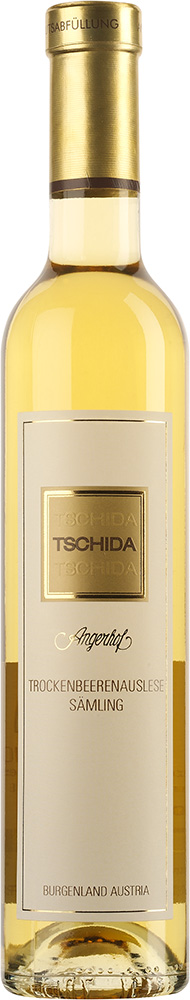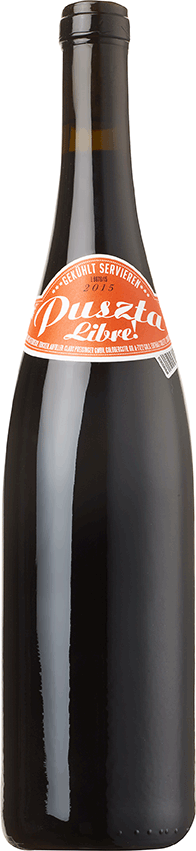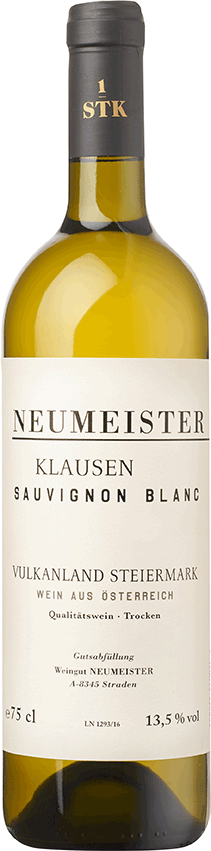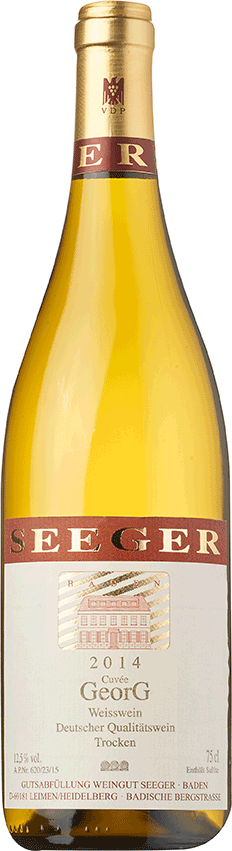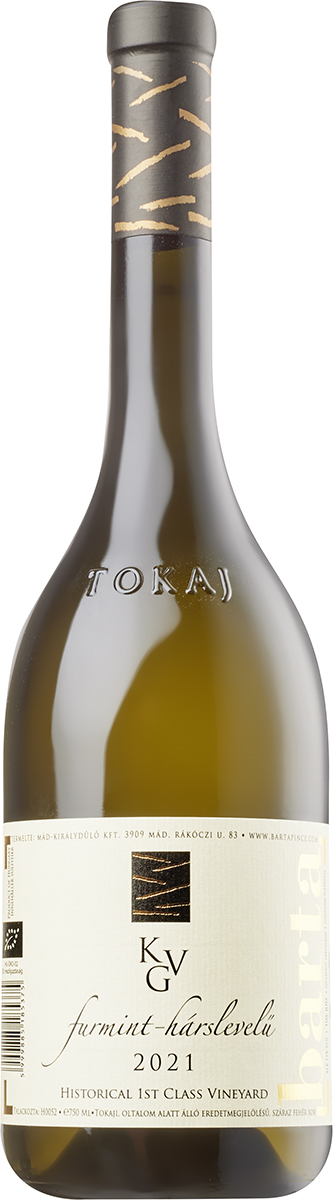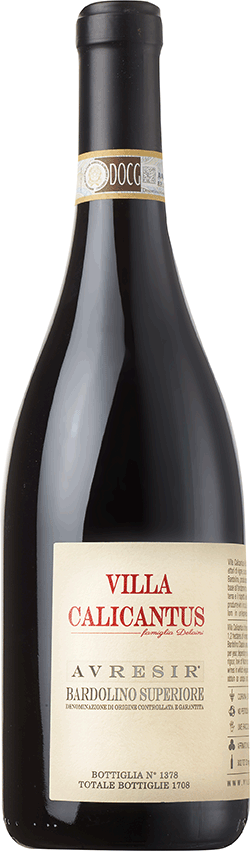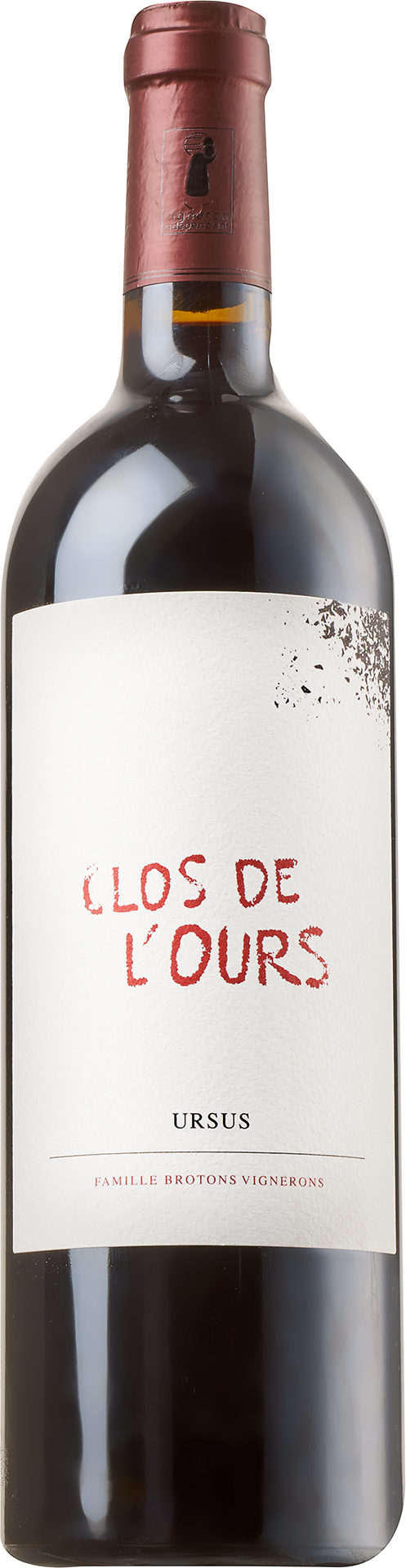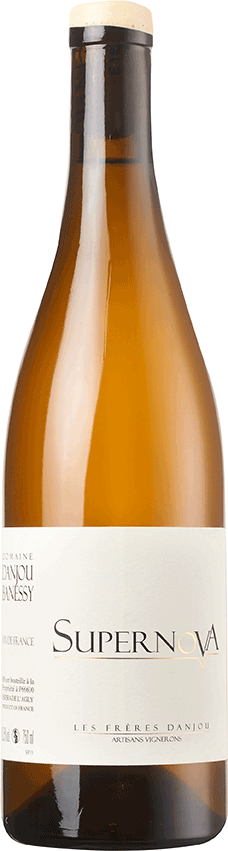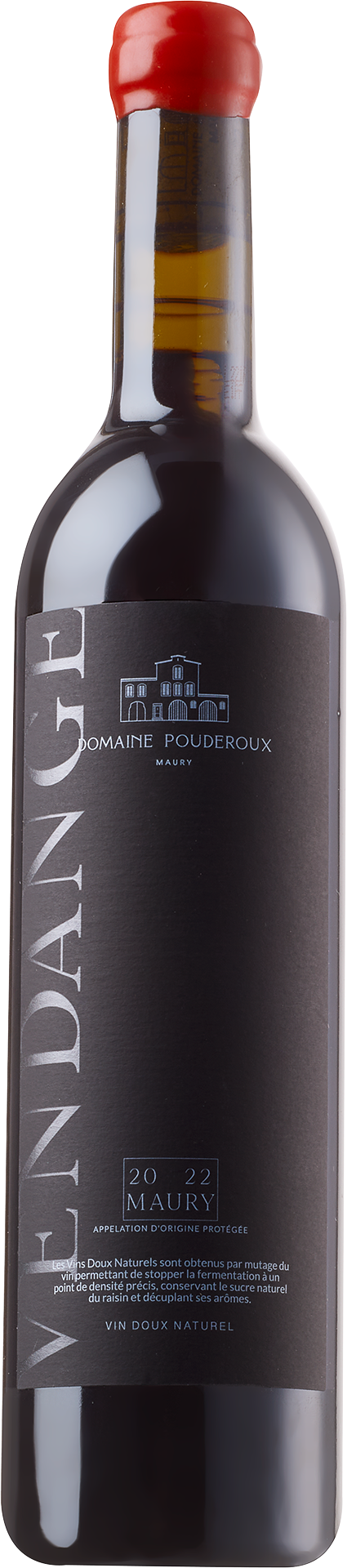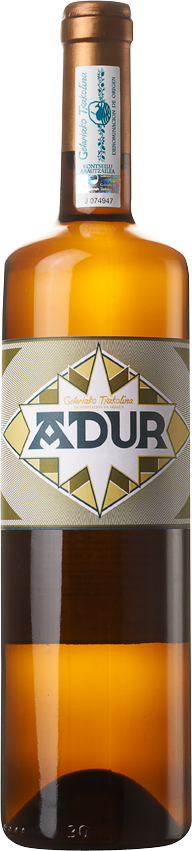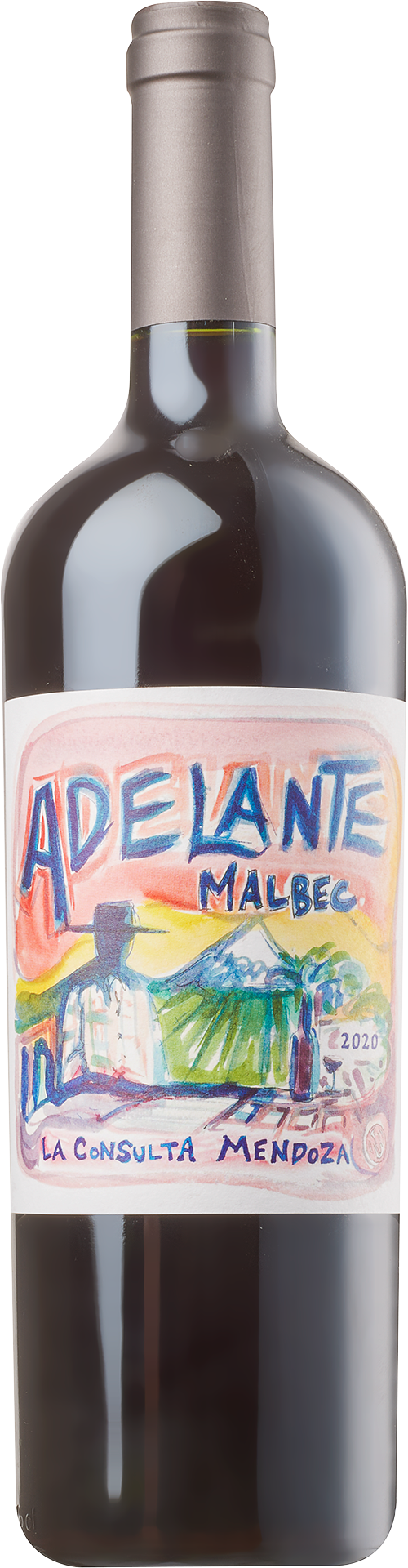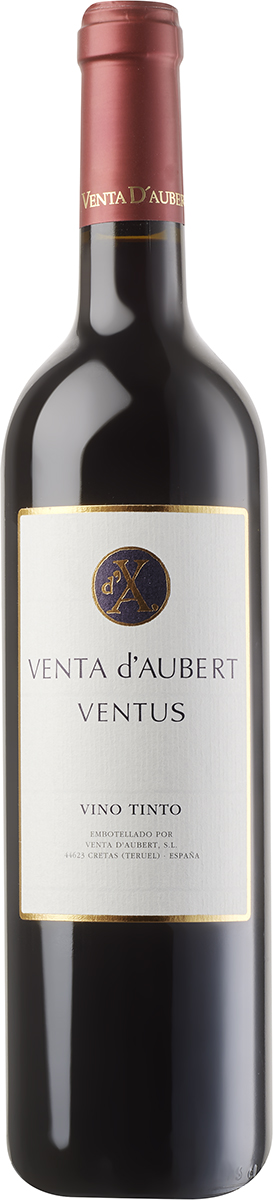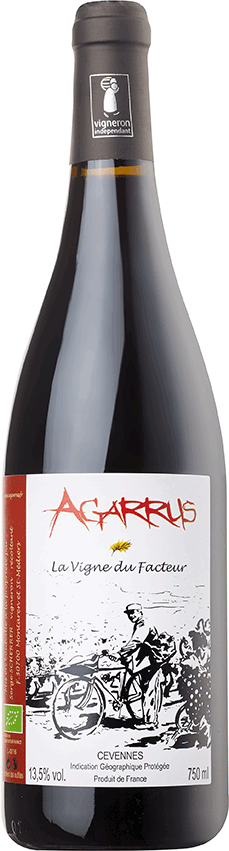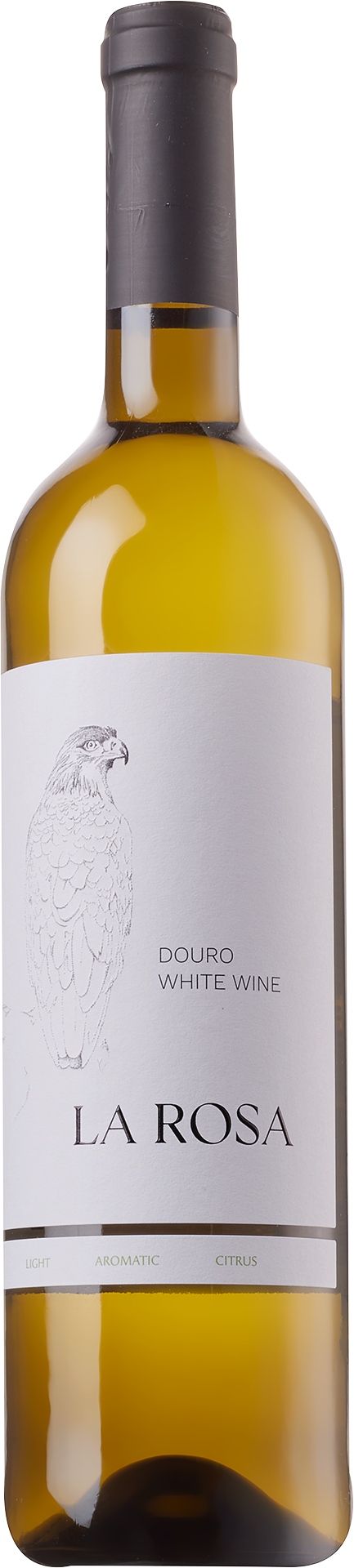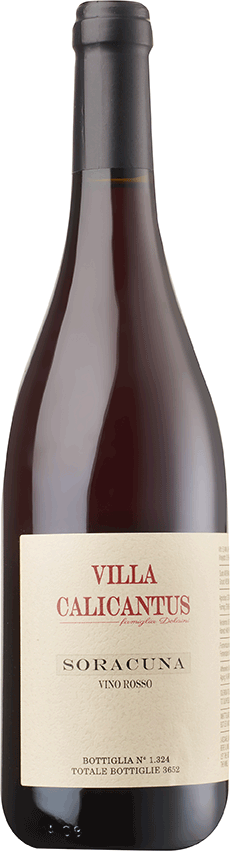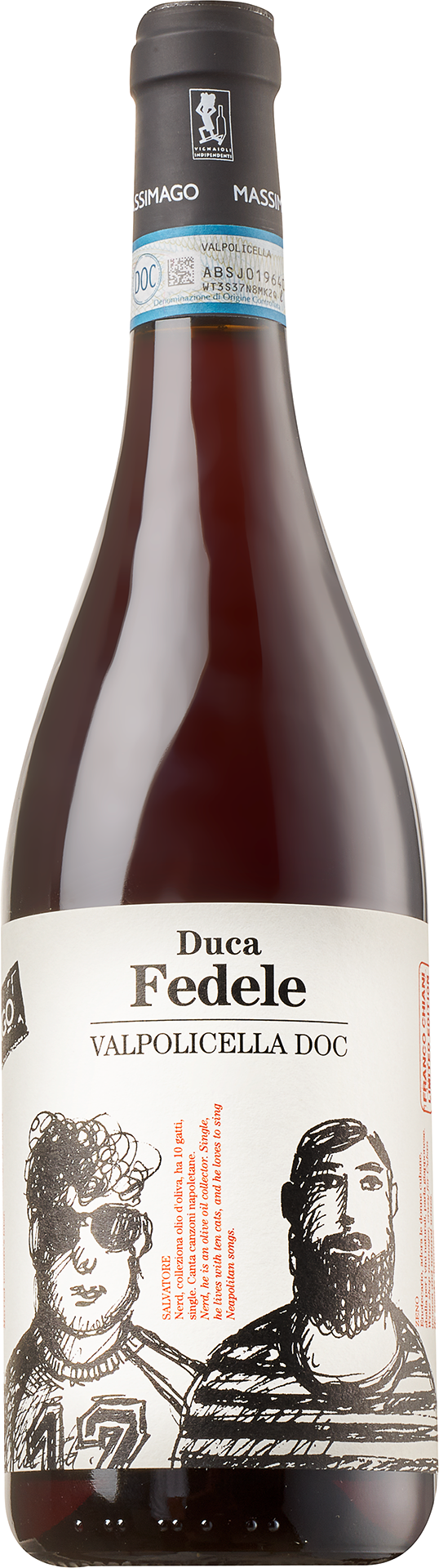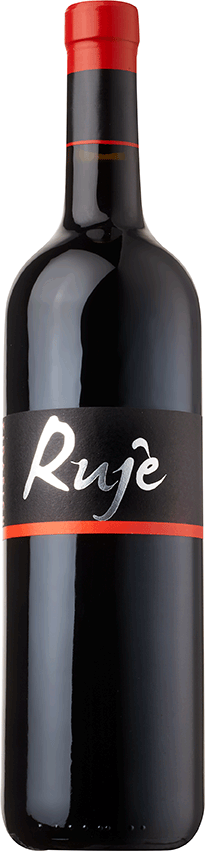Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (22,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (52,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (40,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (120,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (38,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.5 l (52,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (58,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (28,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (44,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.38 l (49,74 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (32,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (16,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (42,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (53,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (32,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (21,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (45,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (30,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (30,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (21,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (44,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (46,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (34,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (22,60 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (44,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (73,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (45,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (56,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (42,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (22,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (32,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (45,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (92,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (33,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (58,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (16,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (45,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (22,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (34,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (37,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (20,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (22,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (30,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,67 €* / 1 l)
Soave
könnte einer der großen Weißweine Italiens sein ...
... wenn man ihn nicht fürs Selbstbedienungsregal bis zur Unkenntlichkeit deformiert und anonymisiert hätte. Es geht auch anders: Vulkanischer Boden, eine autochthone Rebsorte, regenerative Bewirtschaftung und ein Winzer mit Empathie und Vision weisen hier den Weg in die Zukunft eines der großen Regionalweine Italiens

Die perfekte Eiernudel
Nichts für Veganer, aber unglaublich gut schmeckt eine der besten Eiernudeln Italiens: Intensiv nach gutem Mehl und frischen Eiern, zu perfekt bissfester Konsistenz zu garen. In einem Format, das italienischer kaum sein kann: Strozzapreti. Wie so viele traditionelle Nudelformate Italiens haben auch sie ihre Geschichte. Deren Wurzel liegt in jener Völlerei, für die bestimmte kirchliche Kreise Italiens damals bekannt waren. »Strozzapreti«, Priesterwürger, nannte man dieses Nudelformat irgendwann, weil es, so die Sage, Kirchenobere gegeben haben soll, die es so in sich hineinschlungen, daß sie daran erstickten. Gerüchte und Geschichten.
K&U-Mitarbeiterinnen empfehlen ...
... drei besondere Weine. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nah dran am Geschehen. Regelmäßig sind sie vor Ort, sie kennen unsere Winzerinnen und deren Weine oft schon lange, bevor diese auf den Markt kommen. Sie haben dabei die besondere K&U-Perspektive im Ein- wie im Verkauf, denn wir kümmern uns nicht um »den Markt«. Wir kaufen nicht nach irgendwelchen Punkten oder Bewertungen. Wir suchen ausschließlich selbst vor Ort, was wir abseits des Hochglanz-Mainstreams entsprechend unserer eigenen Qualitäts-Kriterien für besonders interessant, gut und wertig halten. Für diese meist weniger bekannten Weine müssen wir den Weg oft erst bereiten. Begleiten Sie uns doch dabei! Hier empfehlen wir Ihnen jeden Monat drei besondere K&U-Weine, an denen wir uns gerne messen lassen:
2020 »Outis« Etna Bianco, Ciro Biondi, Etna, Sizilien 22,00 €
Christoph Schlee: Der Besuch bei Ciro Biondi und seiner Frau Stephanie an der Südseite des Etna war eindrucksvoll. Aus dem Grund eines ehemaligen Kraters ziehen sich auf vielen schmalen Lava-Terrassen die Rebzeilen bis an den Rand eines eingefallenen Kraters hoch. Eine spektakuläre Kulisse, die ich immer im Kopf habe, wenn ich diese Weine im Glas habe. Hier Ciros legendärer weißer »Outis«, gekeltert aus den autochthonen weißen Rebsorten Carricante, Catarratto, Mannella, Muscatella und Bianco di Candia. Im Edelstahltank ausgebaut, potent würzig, leise, interessant. In der Farbe goldgelb. Im Duft weiße und gelbe Blüten, Heu und Apfelschalen mit einem Hauch Zitrus. Im Mund samtig weiche Konsistenz mit salziger Vulkanminerailtät. Eindrucksvoll und unverwechselbar in seinem fast schon magisch »anderen« Etna-Touch.
2020 Cerasuolo d´Abruzzo »Le Vasche«, Caprera, Abruzzen 17,90 €
Dunja Ulbricht: Italien kann mehr als nur Primitivo und Lugana. Keine Angst also vor seinem riesigen Angebot an Rebsorten und Weinen! Machen Sie sich mit uns auf die Reise zum Reiz jener Dynamik, die Italiens alternative Weinszene gerade so unglaublich aufregend macht. Da geht echt die Post ab! Aus den landschaftlich atemberaubend schönen alpinen Abruzzen z. B. kommt ein legendärer Rosé, der Sie unweigerlich an den Herd treiben wird: Cerasuolo. Hier von einem winzigen Bio-Modellbetrieb, dessen Weine pur, urwüchsig und ungeschminkt natürlich ins Glas kommen. Aus der lokalen roten Rebsorte Montepulciano gekeltert. Überraschend weich und samtig im Mundgefühl, körperreich ohne schwer zu sein, pfeffrig würzig und dunkler in der Farbe als der typische Rosé. Unbedingt probieren!
2018 Grignolino »Alvesse«Crealto, Piemont 26,00 €
Martin Kössler: Daß es im Piemont abseits von Barolo und Barbaresco auch noch spannend andere Rebsorten gibt wie Brachetto, Dolcetto, Freisa, Grignolino oder Timorasso scheint nur intimen Kennern der Region geläufig. Das ist schade, denn ihre Vielfalt bereichert jene doch eher teure Einfalt, für die das Piemont hierzulande steht. »Crealto« ist eine winzige Kellerei im piemontesischen Monferrato, in dem Weine ohne Jahrgang entstehen, weil sich die Chefin des Hauses der italienischen Monster-Bürokratie entzieht. Sie darf ihre Weine deshalb nur auf der untersten Stufe der Qualitätshierarchie verkaufen. Ihr im Holzfaß ausgebauter großer Grignolino zeigt sich zart in der Farbe, delikat in der Struktur, typisch spröde in den Gerbstoffen und geradezu mystisch aromatisch im Bukett.
Italiens Nobel-Schaumweine
aus Franciacorta gehören zum Feinsten, was Schaumwein zu bieten hat. Dafür sind sie noch erfreulich preiswert, weil Grund und Boden dort noch nicht so teuer sind wie in der Champagne. Technisch agieren sie allemal auf Augenhöhe. Wenn sie, wie bei 1701, auch noch biodynamisch angebaut und lange auf der Hefe der zweiten Gärung auf der Flasche reifen dürfen, dann erfüllen sie auch höchste Ansprüche an das feine Spiel der belebenden Perlen.
Knochentrocken, Brut Nature. 85% Chardonnay und 15 % Pinot Noir laufen präzise wie ein Laserstrahl über die Zunge. Druckvoll im raffinierten Spiel der Perlung. Aromatisch reif und trotz fehlender Dosage fast cremig wirkend im Mundgefühl. Die überzeugende Alternative zu mancher weit teureren Spitzencuvée der großen Champagner-Marken. Wers nicht glaubt, möge ihn probieren, den mundwässernd frischen 1701 Franciacorta Brut Nature zu 29,90 €.
Noch mehr Wein fürs Geld ...
Seit vielen Jahren studieren junge Leute Weinbau, die zu Hause kein Weingut haben. Sie sind gut ausgebildet, haben in Weingütern auf der ganzen Welt gearbeitet, wollen nun das eigene Weingut gründen. Dazu suchen sie Rebland in weniger bekannten Regionen, weil es dort oft noch bezahlbar ist. Sie produzieren dann mit Leidenschaft und Kompetenz Weine aus meist lokal angestammten Rebsorten, technisch brillant realisiert, in Stil und Geschmack eigenständig, selbstbewußt und originell. Solche Weine suchen wir. Egal ob von jungen oder schon bekannteren Betrieben. Weil sie konsequent handwerklich, also von Hand, hergestellt werden, rechtfertigen sie ihr Preis-Genuß-Verhältnis auf höchst erfreuliche Weise.
Hier ein paar solcher exemplarisch Preis werten Weiß- und Rotweine. Ideale Essensbegleiter. Aus zertifiziert biologischem Anbau. Manche sind auch Naturweine, maßvoll, minimal oder gar nicht geschwefelt, alle spontan vergoren, ohne Zusatzstoffe der Önologie realisiert und aus überschaubar großen bzw. kleinen Familienbetrieben, die für traditionelles Winzerhandwerk im Sinne des Wortes stehen.
Inhalt: 0.75 l (17,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,73 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (13,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (11,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (16,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (16,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (12,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (13,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (13,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (17,33 €* / 1 l)
In Italien trinkt man Wein zum Essen. Hier zu Foccacia, Pasta, Piadina, Pinsa und Pizza
Teige aus Getreide enthalten grundsätzlich als geschmacklich entscheidenden Parameter Kohlenhydrate. An ihnen müssen sich passende Weine orientieren. Kohlenhydrate sind höherwertige Zucker, sogenannte »Polysaccharide«, die nicht wasserlöslich und geschmacksneutral sind. Aber sie beeinflussen das Mundgefühl.
Wenn man Brot oder Teig intensiv kaut, spalten sich im Speichel Einfachzucker auf, die mit der Zeit den Eindruck von Süße vermitteln. Die Kohlenhydrate sorgen dabei für spürbar haptische Wirkung, weil sie die Oberfläche im Mund vergrößern. Diese verstärkt die Flüchtigkeit der beteiligten Aromen und mindert so z. B. die Adstringenz, die Wirkung der Gerbstoffe von Rotwein, im Mundgefühl. Man denke an die für sich getrunkene »sauer« und »dünn« schmeckende Sangiovese, die ihre geschmackliche Wirkung in Kombination mit Pasta oder Focaccia in fröhlichsten Trinkfluß verwandelt. Kein Wunder der Sensorik, sondern simple Chemie.
Wirklich authentisch regionale Rotweine aus Italien zeichnet eine eher delikate Struktur mit präsenten Gerbstoffen und mundwässernd frischer Säure aus. Sie sind oft - solo getrunken - nicht wirklich attraktiv, zur Küche das Landes mit ihren Teigen, Tomaten, Gemüsen und den ungesättigten Fettsäuren des Olivenöls aber gehen sie ab wie Schmidts Katze. Hat jeder schon im Urlaub erlebt. Gewachsene Küchen- und Weinkultur, die darauf beruht, daß die im Mehl enthaltenen Proteine und Kohlenhydrate mit den Gerbstoffen des Rotweines so reagieren, daß der Eindruck von mehr Fülle und süffigerer Substanz im Mundgefühl entsteht.
Merke: Die Italiener genießen ihren Wein in guter, alter Eß- und Trinkkultur vor allem zum Essen
In unserer Auswahl zur sinnlichen Teig-Küche Italiens haben auch wir uns dem Diktat der Kohlenhydrate und Proteine unterworfen:
Bitte klicken >>>
Inhalt: 0.75 l (21,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (15,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,53 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (21,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (30,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (29,33 €* / 1 l)
Rebsorten erleben: Sangiovese
Sangiovese hat jeder schon getrunken. Es ist die Rebsorte des Chianti. Wenig bekannt ist, daß innerhalb einer Rebsorte genetische Abwandlungen für große geschmackliche Unterschiede sorgen können. So kennt man z. B. alleine in Burgund ca. 80 verschiedene Varianten von Pinot Noir, die zusammen mit den dort praktizierten unterschiedlichen Arten der Weinbereitung für die enormen Unterschiede in Stil und Charakter der dortigen Weine verantwortlich sind.
Ein Klon, der auf besonders kleine, lockere Beeren gezüchtet wurde, die dicke Schalen besitzen, wird demnach anders riechen und schmecken als eine Massenselektion aus einem bestimmten Weinberg oder einer bestimmten Lage. Auch die Rebsorte Sangiovese, die in Italien in zahlreichen Regionen angebaut wird, gibt es in vielen verschiedenen Varietäten, die sich farblich und in Duft und Geschmack signifikant unterscheiden und oft unter Synonymen angebaut werden, die man nicht miteinander verbindet.
Sangiovese ist also nicht gleich Sangiovese. Das wollen Ihnen unsere beiden Weine hier exemplarisch zeigen. Beide werden aus Sangiovese gekeltert, schmecken aber so unterschiedlich, daß man sie kaum für verwandt halten würde. Wie ist das möglich? Zum Beispiel durch unterschiedliche Arten der Reb-Vermehrung. So hat man die Reben jahrzehntelang in der berühmten Toskana auf hohe Erträge gezüchtet, wodurch die Weine mager, sauer und dünn wurden. Um diesem zu begegnen, hat man Ende der 1990er Jahre den Verschnitt mit den globalen Nobel-Rebsorten Cabernet, Merlot, Syrah, Malbec etc. genehmigt und praktiziert. Dadurch verlor der Chianti Classico aber seine ursprüngliche Identität, weshalb man heute wieder zurückrudert Richtung Sangiovese, die man inzwischen entsprechend gezüchtet hat.
In ärmeren Regionen wie der Emilia Romagna hat man dagegen, zumal auf den abgelegenen Lagen im Hinterland, nicht auf Menge, sondern auf Ertragssicherheit vermehrt, meist mit Massenselektionen aus den eigenen Weinbergen. So entstanden dort ganz eigene Varietäten und Stilrichtungen der Sangiovese, die man lange als minderwertig beurteilte, weil sie nicht farblich konzentriert und mächtig ausfielen, sondern sich in Farbe und Struktur eher fein und elegant präsentierten.
So verändert der Zeitgeist Weinstile und Weingeschmack. Heute, im Zeitalter der Klimakrise, sind die genetischen Eigenschaften der Reben einer der meist diskutierten Punkte unter den Winzern der Welt.
L 2020 »Il Guercio« Toscana Rosso IGP | Tenuta di Carleone | Chianti-Toscana 49,00 €
R 2020 »Vigna Beccaccia« Sangiovese Modigliana | Villa Pappiano | Emilia Romagna 33,90 €
Zwei große Sangiovese-Weine. Die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die weltberühmte Toskana-Sangiovese trifft hier auf die weitgehend unbekannte Emilia-Romagna-Sangiovese. Der Unterschied? Ihre Genetik. Während auf der Tenuta di Carleone jene Sangiovese Grosso steht, die dem Brunello Weltruf brachte, hier von Reben aus dem privaten Weinberg des Önologen Sean O´Callaghan, der sie auch in der ihm eigenen Art ausgebaut hat, stammt die Modigliana-Sangiovese der Villa Papiano von einer alten lokalen Sangiovese-Variante, die ihre Dünnschaligkeit optisch unter Beweis stellt: Sie erinnert in Farbe und elegant filigraner Duftigkeit und Transparenz eher an Pinot Noir, während die deutlich dunklere Sangiovese von Carleone expressiv nach Weihrauch und katholischer Kirche duftet und auf die Zunge die dichte, rustikal spröde Konsistenz der Toskana-Sangiovese spült. Zwei brillant in Szene gesetzte, stilistisch völlig entgegengesetzte Varianten ein- und derselben Rebsorte. Faszinierende Diversität. Keine Frage der Qualität, sondern des Stils.
»WEIN RADIKAL ANDERS«
Kultur- und traditionelle Naturweine aus radikal anderem Handels-Konzept. Eingekauft und kommuniziert in kompetent kritischer Sicht auf Viefalt, Rebe, Boden, Gärung, Mensch und Wein
Neu auf Lager
Alle aktuellen Zugänge in der Reihenfolge ihres Eintreffens. Wenn Sie hier regelmäßig vorbeischauen, verpassen Sie weder Ihren Lieblings-Winzer noch Ihren Lieblings-Wein und sind stets über unsere Neueinkäufe informiert.
Die Rubrik ist so aktuell, daß manchmal noch Flasche und Beschreibung fehlen. Wir reichen sie umgehend nach, denn wir schreiben sie persönlich, weil unsere Weinbeschreibungen Ihnen geschmacklich nachvollziehbare und sprachlich verständliche Orientierung bieten möchten - ohne die vielen Adjektive und Superlative, für die unsere Branche so berühmt wie berüchtigt ist.
Inhalt: 0.75 l (13,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (14,93 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (18,67 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,33 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (19,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (23,87 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (24,00 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (25,20 €* / 1 l)
Inhalt: 0.75 l (26,53 €* / 1 l)
Küche & Wein
40 Jahre K&U. Das Video